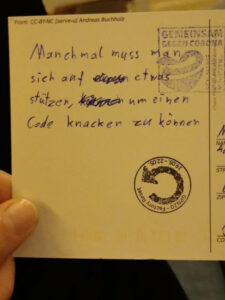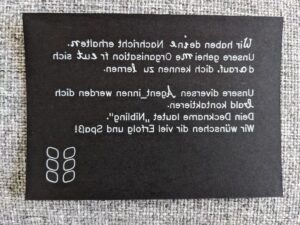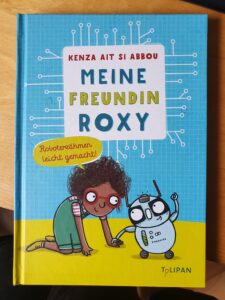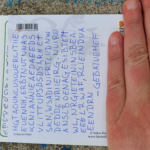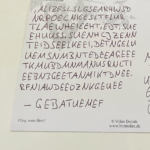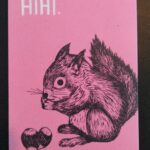Reading Time: 5 minutesHier geht’s zu einem PDF meiner Stellungnahme, und auf der Website des Parlaments findest du den Entwurf selbst und alle dazu veröffentlichten Stellungnahmen.
S T E L L U N G N A H M E zum Ministerialentwurf betreffend Bundesgesetz, mit dem das Universitätsgesetz 2002, das Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz und das Hochschulgesetz 2005 geändert werden (GZ: 2020-0.723.953)
Sehr geehrter Herr Bundesminister Faßmann, sehr geehrte Damen und Herren!
Als Master-Studentin der Informatik und Hauptmitglied des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen an der TU Wien, ehemalige Studierendenvertreterin an der HTU Wien und der Bundesvertretung, sowie Jungwissenschaftlerin/Angestellter an der TU Wien möchte ich Stellung zum vorliegenden Entwurf nehmen.
Der vorliegende Entwurf möchte einige tatsächliche Probleme im Hochschulbetrieb angehen, scheitert daran aber in großen Zügen. Unter die problematischen Neuerungen fallen sozial selektive Maßnahmen wie die Einschränkung der Zulassungsfristen, die Einführung einer Mindeststudienleistung und Änderungen an der Universitätsleitung zu Ungunsten einer demokratischen, partizipativen Herangehensweise sowie einige Neuregelungen im Bereich des AKG. Hier meine Kritik im Detail:
Zu §22. (1) Z12 und Z12a.
Die geplanten neuen Rechte des Rektorates erlauben umfassende Eingriffe in Curricula. Diese Kompetenz sollte beim universitären Senat und seinen Arbeitsgruppen, insbesondere den Studienkommissionen, verbleiben. Den Bedarf nach Eingriffen durch in der Regel fachfremde Personen kann ich nicht nachvollziehen.
>> Diese Punkte sollten ersatzlos verworfen werden.
Zu §23b. (1)
Die Kontrolle der:des Rektor:in durch den Senat ist gut und wichtig. Eine zweite Amtszeit ausschließlich vom Universitätsrat abhängig zu machen, stellt eine Entmachtung des Senats dar. Da der Universitätsrat zur Hälfte von der Regierung besetzt wird, ist ein (politischer) Eingriff in die Freiheit der Lehre und Forschung eine denkbare, und bedenkliche, Folge.
Sollte der Senat im Rahmen der Anhörung feststellen, dass eine Wiederbestellung abzulehnen ist, und der Universitätsrat dennoch an einer Wiederbestellung festhalten, so wäre dies dem inneruniversitären Klima für die kommenden vier Jahre nicht dienlich.
Außerdem besteht zu diesem Thema die grundsätzliche Frage der rechtlichen Zulässigkeit, welche von Jurist:innen zunehmend angezweifelt wird (z.B. Anna Gamper, Peter Bußjäger: Universität Innsbruck).
>> Diese Änderungen sollten ersatzlos verworfen werden.
Zu § 42 Abs. 2
Der AKG ist primär ein Aufsichts- oder Kontrollorgan und kein Vertretungsorgan wie etwa der Senat oder der Betriebsrat. Seine Aufgabe ist, sicherzustellen, dass Angehörige marginalisierter Gruppen an den Hochschulen möglichst ungestört forschen, studieren, arbeiten und sich entwickeln können. Ein Gremium, das sich mit Minderheitenrechten befasst, durch allgemeine Wahlen zu beschicken, ist ein Paradoxon.
Ebenfalls nicht hilfreich für die Arbeit im AKG wäre es, Paritäten fix festzulegen. Es ist ohnehin schon oft schwierig genug, neue Mitglieder zu finden, ohne dass diese noch weitere Merkmale mitbringen müssen (beispielsweise Professor:innen).
>> Diese Punkte sollten ersatzlos verworfen werden.
Zu §58 (12)
Es ist definitiv begrüßenswert, dass knapp 20 Jahre nach Einführung des European Credit Transfer Systems endlich die entsprechenden Credits auch erstmals evaluiert – und an die realen Arbeitsanfordernisse angepasst – werden sollen. Leider fehlt jedoch weiterhin eine Definition, wie dieser Arbeitsaufwand zu beschreiben ist.
Des Weiteren sind regelmäßige Evaluierung, transparente Maßstäbe, sowie Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung notwendig.
>> Der Absatz sollte präzisiert und erweitert werden, z.B. “Dies ist jährlich zu evaluieren. Die Evaluationsergebnisse sind in ihrer Gesamtheit allen Mitgliedern des universitären Senats und seinen Arbeitsgruppen, insbesondere den Studienkommissionen, zur Verfügung zu stellen.”
Zu §59a
Die Idee einer Mindeststudienleistung, deren Nicht-Erreichen eine Exmatrikulation sowie automatische Sperre von 10 Jahren bedeutet, ist völlig inakzeptabel. Hier wird auf dem Rücken ohnedies schon benachteiligter Studierender, unter Berufung auf das Bild von “Party-Studis” bildungsfeindliche Politik gemacht.
Die Regelung trifft insbesondere jene, die nicht 100% ihrer Zeit dem Studium widmen können – sei es aus finanziellen (>60% der Studierenden sind laut Studierendensozialerhebung neben dem Studium berufstätig), familiären, oder gesundheitlichen Gründen. Die in §59a (5) formulierte Ausnahme für behinderte Studierende verwendet eine viel zu enge Defintion und schließt damit viele Studierende mit psychischen und chronischen Erkrankungen aus.
>> Diese Punkte sollten ersatzlos verworfen werden.
Zu §59b. (4)
Learning Agreements, die als privatrechtliche Verträge in öffentliches Recht eingegliedert werden sollen, vermischen zwei rechtliche Bereiche, die aus gutem Grund getrennt sind. Diese Verträge erhöhen den psychischen Druck auf Studierende und diskriminieren jene, die solche Verträge nicht abschließen wollen. Außerdem können jederzeit unvorhergesehene Ereignisse eintreten, die zu ungerechtfertigten Sanktionen für diese Studierenden führen können.
>> Ich empfehle, diese Änderung ersatzlos zu streichen.
Zu §59 (5)
Die Einschränkung der für Gremienarbeit in Frage kommenden Studierenden wird Probleme für die Kontinuität in den Gremien bedeuten, da Studierende später in diese Arbeit einsteigen und kürzer bleiben können; die auflaufende Arbeit muss auf weniger Studierende verteilt werden; und es wird schwieriger, die Bedürfnisse und Perspektiven der niedrigsemestrigen Studierenden in die Gremien einzubringen.
Durch die Änderung ist eine Entdemokratisierung der Gremien und ein Verlust an Arbeitsqualität ebendort zu befürchten.
>> Ich empfehle, diese Änderung ersatzlos zu streichen.
Zu § 61/62
Es gibt keinen guten Grund für eine Streichung der Nachfrist und eine Deregulierung der Fortmeldezeiträume.
Die Streichung verhindert einen nahtlosen Wechsel aus der Schule bzw. dem Präsenzdienst in die Hochschule genauso wie den Übergang vom Bachelor- in das Masterstudium. Studierende, die in der alten Nachfrist ihr Studium abschließen würden, hätten ein Semester länger Studienbeiträge zu bezahlen, und die Studienzeit würde künstlich verlängert. Beides würde zu unnötigem finanziellen und psychischen Druck führen.
Zusätzlich müssen durch das Verkürzen der Semester in §61 (2) bisher gern genutzte Prüfungszeiträume verlegt werden. Dies bedeutet weniger Zeit am Ende des Semesters für Prüfungen sowie enger zusammen liegende Termine.
>> Ich empfehle, diese Punkte ersatzlos zu streichen.
Zu § 66 (4)
Die Studieneingangs- und Orientierungsphase der Informatik an der TU Wien ist bereits jetzt nachweislich eine der restriktivsten in ganz Österreich. Duch das Wegfallen der Möglichkeit, die StEOP erneut anzugehen, führt bei Studierenden zu mehr Stress und Angst, was wiederum zu einem schlechteren Abschneiden bei Prüfungen und damit zu mehr Abbrüchen führen und die Informatikstudien in Österreich noch unattraktiver machen wird.
>> Ich empfehle, diese Änderung ersatzlos zu streichen und die StEOP abzuschaffen.
Zu § 67
Dass eine Beurlaubung innerhalb des ersten Semesters nur noch aus einer handvoll Gründen möglich sein soll, die z.B. einen plötzlichen Trauerfall nicht beinhalten, ist nicht nachvollziehbar. Ein entsprechender Fall würde zu einer Studienzeitverzögerung führen sowie das Risiko bedeuten, die erforderlichen ECTS für die Mindeststudienleistung (und damit Fortsetzung des Studiums) zu erreichen.
>> Ich empfehle, diese Änderung ersatzlos zu streichen.
Zu § 76 (3)
Der Vorschlag, nur noch jedenfalls 2 statt wie bisher jedenfalls 3 Prüfungstermine pro Semester anzusetzen, steht im direkten Widerspruch zu dem Ziel, effizientes und (prüfungs-)aktives Studieren zu fördern. Diese Änderung geht zu Lasten von Studierenden, die ihr Studium flexibel betreiben möchten oder müssen (siehe Punkte zu §59a). Prüfungen werden auf wenige Termine zusammengelegt, wodurch ein größerer Druck besteht, einen Prüfungsplatz zu ergattern. Ein Anstieg psychischer Belastung ist dabei nicht zu vermeiden.
>> Ich empfehle, diese Änderung ersatzlos zu streichen.
Zu §89 und §116a (6)
Eine Verjährung erschlichener Leistungen wäre gerade angesichts aktueller Fälle mit einem beträchtlichen Imageschaden für die Republik Österreich verbunden. Außerdem sehe ich es extrem problematisch an, einerseits Ghostwriting unter Strafe zu stellen, gleichzeitig jedoch die Konsequenzen für Plagiate zu lockern und diese sogar verjähren zu lassen.
>> Ich empfehle, diese Änderung ersatzlos zu streichen.
Zu §109
Die im Entwurf geplante Beschränkung der Dauer befristeter Arbeitsverhältnisse muss mit wirksamen Maßnahmen zur Entfristung der Arbeitsverhältnisse an den Universitäten gekoppelt sein. Ansonsten gefährdet diese Änderung nicht nur das Auskommen der betroffenen Arbeitnehmer:innen, sondern auch die Qualität und Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs an den Hochschulen. Auch die Gefahr eines Brain Drain weg von österreichischen Institutionen kann nicht unterschätzt werden.
Abschließend:
Während, wie gesagt, einige tatsächlich bestehende Probleme mit dieser Novelle aufgegriffen werden, und die Ziele nachvollziehbar und sinnvoll sind, sind die präsentierten Lösungsansätze im Großen und Ganzen misslungen und ignorieren die tatsächlichen Lebensrealitäten vieler Universitätsangehöriger.
Ich hätte mir erwartet, dass eine so umfangreiche Novelle nicht über die Weihnachtsferien während einer Pandemie zur Begutachtung vorgelegt wird. Dies umso mehr, als z.B. die Novellierung des Studienförderungsgesetztes (Anhebung der Zuverdienstgrenze) seit dem Herbst auf Beschluss wartet. Die UG-Novelle sollte bis zur endgültigen Dämpfung der Pandemie und ihrer Folgen auf Eis gelegt und dann nocheinmal vom Start weg angegangen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Sabrina Burtscher